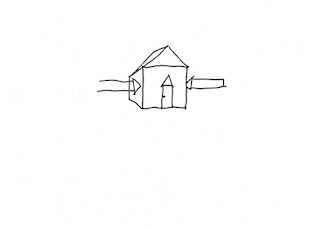Eine der grundlegendsten Unterscheidungen, die der Mensch treffen kann und die die Grundmuster eines jeden sozialen Gefüges bilden, besteht in den Kategorien „Drinnen“ und „Draußen“. Noch bevor diese Bezeichnung auf soziale Differenzierungen angewandt worden ist, diente sie dazu, den Ort des Menschen in der umgebenden Natur zu bestimmen und ihn davon abzugrenzen. Sicher gehört diese selbstreflexive Unterscheidung zu einem der entscheidenden Schritte auf dem Weg der Menschwerdung. Die Schutzhütte und später das Haus waren der gezähmte Bereich des Menschen, die Welt draußen war der Bereich der wilden, ungezähmten Natur.
 |
| Vernissage, v.l.n.r. Elke Suhr, Dr. Thomas Piesbergen, Publikum |
Dem Gesetz der Form und dem Indikationen-Kalkül von John Spencer-Brown folgend, ist das „Draußen“ aber auch immer ein Teil des „Drinnen“, Teil des menschlichen Standpunktes, denn es kann nur dann erkannt und darauf hingedeutet werden, wenn es bereits vorher im „Drinnen“ als Konzept angelegt war. Diesen ersten Bruch der Symmetrie der Ganzheit fand Spencer-Brown hervorragend im Symbol des Yin und Yang dargestellt: das schwarze Yang enthält einen weißen Kreis, der farblich dem Yin entspricht, geometrisch der Ganzheit von Ying und Yang. Beim Yin verhält es sich entsprechend komplementär.
Dieser grundlegenden Bedingtheit der Unterscheidung folgend findet man in allen vormodernen Kulturen - und in Rudimenten auch in den industriellen und post-industriellen Kontexten - eine Analogie zwischen dem Haus und der Welt. Das Haus umschließt den Bereich des Menschlichen und grenzt ihn vom Außermenschlichen ab, repräsentiert aber gleichzeitig die Gesamtheit der Außenwelt, in deren Zentrum sich die Innenwelt befindet.
Im indonesischen Bereich wird das Wort „Banua“ z.B. nicht nur für das Wohnhaus gebraucht, sondern synonym auch für das Dorf, den Himmel oder die Welt. Auch in unserem kulturellen Kontext müssen wir nicht lange suchen, um auf Formulierungen wie „Himmelszelt“ oder „Das Dach der Welt“ zu stoßen, die auf eine solche Analogie schließen lassen.
Da sich die Lebenswirklichkeit vormoderner Kulturen vor allem durch religiöse Bedeutungsmuster konstituiert, und die Welt als von Geistern oder göttlichen Kräften geordnet und gelenkt verstanden wird, liegt es auf der Hand, daß das Haus gleichzeitig auch zu einer Repräsentation der göttlichen Ordnung der Welt wurde.
Das Haus war also nicht nur ein physischer Schutzort und ein Raum, in dem der Mensch seiner Sicht auf die Welt einen formalen Ausdruck gab, sondern auch der Ort, an dem er in Anschauung und im Nachvollzug dieser Ordnung mit den Kräften, die die Wirklichkeit beherrschten, in Kontakt trat, lange bevor diese Funktion schließlich in den Tempel ausgelagert wurde.
Das Haus ist also von Anbeginn der Kultur nicht nur ein Ort des Schutzes, sondern auch ein Ort der Anschauung und der Einkehr, der spirituellen Praxis gewesen.
Zudem wurde für die Anwesenheit des Göttlichen in fast allen Kulturen ein architektonischer Rahmen geschaffen, in der Regel ein Haus: der Tempel oder die Kirche. So lebten auch die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste zwar in Zelten, für die Bundeslade hingegen wurde die sog. Stiftshütte gebaut, über der eine Wolke schwebte, um die Anwesenheit JHWHs anzuzeigen.
Verfolgt man von diesem Punkt aus die Entwicklung menschlicher Siedlungen, wird deutlich, daß bis in die frühe Neuzeit einerseits die Bedeutung des individuellen Hauses und andererseits die Repräsentation kosmologischer und religiös motivierter Ordnungsprinzipien den Siedlungen ihre Strukturen gaben.
In den ersten stadtartigen Siedlungen des Nahen Ostens wurden die Häuser oft Wand an Wand gebaut und die Siedlungen so verdichtet, daß die Dächer als Wegenetz genutzt werden mußten. Regelrechte Wege wurden nicht angelegt. Wenn sie entstanden, dann nur als zufällige Verkettungen ungenutzter Flächen und ebenerdiger Wirtschaftsbereiche.
Erst durch die Auslagerung der religiösen Zentren aus den Wohnhäusern in separierte Gebäude, die Tempel, entstanden regelrecht angelegte Straßen, die mehr waren, als nur unbebauter Raum im urbanen Kontext. Sie waren allerdings nicht primär als Transportwege gedacht. Es waren Zeremonialstraßen. In ihrem Fluchtpunkt lag ein Tempel oder später ein Palast. Häufig rekapitulierte ihre Anlage auch das Ordnungskreuz und repräsentierte so einmal mehr die kosmologisch bedingte Ordnung der Welt.
Selbst der Ursprung der griechischen und römischen Stadtpläne geht zurück einerseits auf das von Anaximander postulierte Gesetz der göttlicher Ordnung der Welt, die sich z.B. im Raster des Stadtplans von Milet niederschlug, andererseits auf die etruskische Weltordnung nach dem Kreuz mit den Achsen Cardo und Decumanus, die die Römer später übernahmen und tradierten.
Auch wenn diese Stadtpläne auf uns einen modernen Eindruck machen, haben sie in erster Instanz einen kosmologisch-religiösen Hintergrund, der später auch im Sinne manifest gewordener Herrschaftsstrukturen reproduziert wurde, sie gehen aber weder auf unabhängige stadtplanerische Konzepte, noch auf infrastukturelle Überlegungen zurück.
Nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches brachen die antiken Traditionen der Stadtplanung ab. Städte wuchsen wieder organisch und regellos. Von primärer Bedeutung waren die individuellen Häuser, nicht aber die Gesamtanlage oder das Straßen- und Wegenetz, was sich erneut den Gebäuden anpaßte.
Erst im Laufe der Renaissance kehrte das Raster als Planungswerkzeug zurück. Doch bereits in der Hochrenaissance bahnte sich mit William Harveys Entdeckung des Blutkreislaufs ein gänzlich anderes Verständnis der Städte an:
In einer immer rationaler werdenden Welt begann man das Gemeinwesen als eigenständigen Organismus zu begreifen. Den Straßen wurde die Bedeutung der Blutgefäße zugewiesen und damit erstmals eine zentrale Bedeutung für das Funktionieren der Städte. Sie galten von nun an als existentiell für die Versorgung der Städte und rückten in das Bedeutungszentrum der Stadtplanung. Mit diesem gedanklichen Schritt wurde eine Eskalation in Gang gesetzt, die durch den Automobilismus einen weiteren, entscheidenden Impuls erhielt, und die bis heute ungebremst anhält:
Das Primat der Mobilität, das heute maßgeblich das Gesicht der Städte bestimmt. Der Aspekt der Infrastruktur gilt meist als entscheidender Maßstab für die qualitative Bewertung von Wohnorten. Die Straßen folgen nicht den Häusern, die Häuser folgen den Straßen. Eines der berühmtesten Beispiele dieser hierarchischen Folge ist das New Yorker Flatiron Building. Es erhielt seine charakteristische Form nicht aufgrund einer spezifisch gestalterischen Absicht, sondern ausschließlich durch den Vorsatz einer vollständigen Ausnutzung des von Straßenverläufen vorgegebenen Baugrunds. Es ist in den Straßenverlauf eingepaßt.
Durch die Automobilisierung seit dem frühen 20. Jhd. wurden zudem die Bereiche des Wohnens, Arbeitens und Einkaufens immer mehr auseinander gerissen und der Mensch zu einer nahezu ununterbrochenen Raserei von einem Ort zum anderen verdammt. Straßen verbinden nicht mehr nur Orte, sondern machen auch ihre Entfernung voneinander kenntlich. Und je größer, je stärker befahren sie sind, desto mehr stellen sie auch Grenzen dar, die die linke Seite des Fahrdamms von der rechten trennen.
In dieser zirkulierenden, lärmenden Raserei steht das Haus noch immer still. Doch meist ist es nicht mehr der Ort der Einkehr. Durch die Auslagerung des Sakralen aus dem Bereich des Wohnens ist es profanisiert worden. Die spirituelle Praxis ist im modernen Haus und der modernen Wohnung nicht mehr vorgesehen. Zu ihrer Ausübung muß sich der Mensch einmal mehr dem Alltagsnomadismus überlassen. Zudem kolonisiert die immaterielle Seite der Raserei, der Lärm, nicht selten unsere Rückzugsräume in einem Umfang, daß die Aufmerksamkeit nur schwer nach Innen zu richten ist, da sie von aufreizenden akustischen Signalen immer zu dem Geschehen auf der Straße gezogen wird. Und damit nicht genug: der vormalige Ort der Ruhe wird durch die virtuelle Raserei der Massenmedien, in der sich das Primat der Mobilität und der Überwindung von Raum fortsetzt, während wir physisch eigentlich schon zum Stillstand gekommen sind, mehr und mehr zu einem Ort der Betäubung und Flucht in virtuelle Realitäten geworden. Das ehemals spirituell belegte Zentrum ist nicht nur leer geworden, sondern ausgelöscht.
Dieser lose umrissene Komplex ist Ausgangspunkt zahlreicher künstlerischer Ansatzpunkte von Elke Suhr, die sie gerne mit dem Konzept der petit perception von Leibniz vergleicht: intuitive gedankliche Impulse, die noch nicht zu einer bewußten und klar artikulierten Form gefunden haben, die Auslöser sind für ein sich Vorantasten und Nachspüren.
Einer dieser kleinen gedanklichen Impulse beschäftigt sich mit dem eben erwähnten Phänomen der Durchdringung des Raums durch den Lärm, den bereits der futuristische Maler Umberto Boccioni 1911 in seinem Bild „Der Lärm der Straße dringt ins Haus ein“ thematisierte.
 |
| Elke Suhr, Variationen auf Boccionis " Der Lärm der Straße dringt ins Haus ein", 2015 |
Elke Suhr stellt Boccionis Bild in Dialog mit einem gestrickten Ausschnitt des Balkongeländers, über den sich die Rückenfigur Boccionis beugt. Die Farbe der Rückenfigur ist allerdings durch den imaginierten Lärm aus dem Haus ausgetrieben und Teil der Außenwelt geworden. Man sieht ihr gestricktes Blau jenseits des gestrickten Geländers, dort, wo man in der Vorlage das Straßenpflaster und einzelne Figuren sieht. Auf einem Video dahinter verweben sich im Dialog mit dem gestrickten Material die sinnlosen Bewegungsvektoren der Automobile.
 | |
|
 |
| Elke Suhr, "Das stille Stehen der Häuser", 2015 |
 | ||||
|
 |
| Elke Suhr, "Das stille Stehen der Häuser", 2015 |
Auf den Zeichnungen Elke Suhrs stehen sich Punkt und Linie gegenüber: Die Linie als die nicht verharrende Bewegung, der Punkt als das bewußte Innehalten und Verweilen, und, denkt man sich die Linie auf der Horizontalen, der Punkt als Querschnitt eines aus der Horizontalen aufsteigenden Vektors, als Querschnitt der Weltachse, die den Aufstieg von der horizontalen diesseitigen Welt auf eine geistige Ebene ermöglicht.
Zentral sehen wir eine aus mehreren Elementen zusammengesetzte Arbeit: Vor einem Blatt mit den „Acht Rechtecken“ vom Malewitsch (1915) erheben sich zwei weiße aus Papier gefaltete Quader; leichte, fast immateriell wirkende Objekte, vor dem faktischen Zugriff auf ihre Stofflichkeit geschützt durch eine Glasvitrine, die rückwärtig gestützt wird durch einen verzogenen Backstein.
Zwei der Rechtecke des ausgebildeten technischen Zeichners und studierten Architekten Malewitsch werden zu Grundrissen umgedeutet und bringen Modelle, lediglich gedachte Häuser hervor. Hier imaginiert sich der Geist seinen eigenen Schutzraum.
Rückendeckung erhält er dabei von dem Backstein, der durch seine stark deformierte Ecke wirkt, als sei er selbst nur mit Müh und Not der horizontalen Raserei entkommen. Zwar wird er durch dieses Handicap nicht mehr selbst Bestandteil eines Hauses sein können, aber er stabilisiert, selbst in die Vertikale aufgerichtet, den zur Form aufgestiegenen Gedanken.
 |
| Elke Suhr, "Das stille Stehen der Häuser", 2015 |
Richard Sennet, dessen Schriften das neuere Schaffen von Elke Suhr stark inspiriert haben, schreibt in „Fleisch und Stein“, wir Menschen lebten nur noch als Verbannte miteinander. Verbannt von dem Ort der Ruhe und Einkehr, verbannt aus dem Innenraum, aus dem Haus, das unsere Ordnung der Wirklichkeit repräsentiert und in dem wir mit den Kräften, die dieser Ordnung Ausdruck und Gestalt geben, in Kontakt treten können - nämlich mit uns selbst.
Ausstellungen wie die von Elke Suhr mit ihren künstlerischen petit perceptions können uns bei der Bewußtmachung dieser Verbannung und dem Versuch, sie zu überwinden, sehr hilfreich sein.
ⓒ by Dr. phil. Thomas J. Piesbergen / VGWort, Dez. 2015